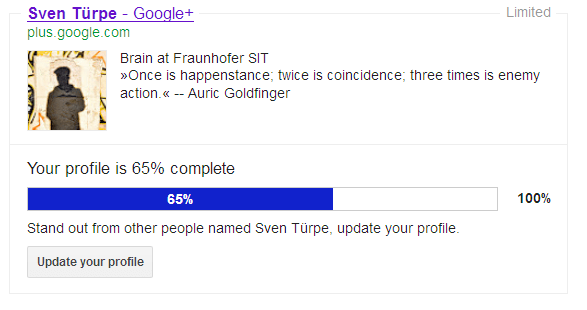Politiker und Bürokraten wollen die Verwendung von Cookies gesetzlich regulieren, erst die EU (mit unklarem Regelungsgehalt und schleppender Umsetzung), ein paar Jahre später nun auch die SPD. Warum ist das blöd? Ich hole mal etwas weiter aus:
Persönliche Computer, PCs, waren in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts eine große Sache. Jedem seinen eigenen Computer, klein genug für den Schreibtisch und mit verschiedenen Anwendungsprogrammen für vielerlei Zwecke einsetzbar, das hatte es vorher höchstens als Vision gegeben. Aus dieser Frühzeit der Jedermann-IT stammen viele Vorstellungen, die wir noch heute hegen, darunter die Wurzeln unseres Datenschutzes.
Auf den ersten Blick hat sich seitdem wenig geändert. Aus dem PC auf Arbeit wurde ein Gerätezoo für alle Lebenslagen aus PCs, Note- und Netbooks, Smartphones, Tablets, Internetradios, Spiekonsolen und so weiter, technisch im Grunde genommen immer noch persönliche Computer, nur schöner und kleiner und schneller. Seit den 90er Jahren folgte dem Jedermann-Computer das Jedermann-Netz und im folgenden Jahrzehnt wurde dieses Netz mobil und sozial. Allen Schichten gemein ist, dass ihre Nutzer in Selbstbedienung nach Bedarf Dienste einkaufen, die nach dem Umfang der Nutzung bzw. den zugesicherten Ressourcen abgerechnet werden. Dienstanbieter stellen aus einem Pool an Ressourcen ohne Zeitverzug die jeweils nachgefragten Dienste bereit.
Die jetzige Dekade wird das Jahrzehnt des Cloud Computing. So wie der PC in den 70ern entstand und in den 80ern seinen Namen bekam und sich verbreitete, ist Cloud Computing keine ganz neue Sache, sondern längst erfunden, einsatzbereit und zum Teil auch schon etabliert. Neu ist nur, dass es jetzt einen Namen dafür gibt und alle ein Geschäft wittern, nachdem die Early Adopters vorgemacht haben, dass es funktioniert.
Cloud Computing bedeutet, dass ein Großteil der IT als Dienst ins Netz wandert. Das kann auf verschiedenen Abstraktionsebenen geschehen. Infrastructure as a Service (IaaS) bietet virtuelle Maschinen und Speicher, Platform as a Service (PaaS) liefert Anwendungsplattformen und Software as a Service (SaaS) schließlich macht Anwendungssoftware zu einem Dienst. Ein Beispiel für SaaS ist wordpress.com, wo dieses Blog gehostet wird. Die Schichten lassen sich stapeln, ein SaaS-Anbieter kann auf PaaS-Dienste zurückgreifen, die sich ihrerseits auf IaaS stützen. Die unteren Schichten IaaS und PaaS sind vor allem für Unternehmen interessant, während SaaS in Form von allerlei Webdiensten längst Teil unseres Alltags ist und die klassische Nutzung von Anwendungssoftware auf einem PC teils ersetzt, teils ergänzt.
Geht es um Sicherheit und Datenschutz im Cloud Computing, starren alle wie gebannt auf die Dienstseite. Daten wandern ins Netz, ob aus dem Rechenzentrum eines Unternehmens oder vom heimischen PC, und man weiß nicht genau, wo sie eigentlich gespeichert und verarbeitet werden. Das macht Angst und wirft technische, organisatorische und rechtliche Fragen auf. Hinzu kommt, dass der Übergang von Software in Kartons zu Diensten im Netz in Verbindung mit agilen Entwicklungsmethoden die Softwareentwicklungs- und -lebenszyklen verändert. Es gibt kein Google 3.0, das ich kaufen und dann ein paar Jahre verwenden könnte, sondern Änderungen am Dienst im Wochen-, Tage-, Stunden- und sogar Minutentakt. Continuous Deployment und DevOps nennen wir diese bewusste Vermischung von agiler Entwicklung und Produktivbetrieb.
Ein SaaS-Dienst ist nicht in sich abgeschlossen und unabhängig vom Rest des Netzes, sondern es handelt sich, für Nutzer manchmal schwer erkennbar, um eine Aggregation mehrerer Anwendungs- und Hilfsdienste, ergänzt um spezifische Funktionen des aggregierenden Hauptdienstes. Like-Buttons, Widgets, Videos, RSS-Feeds, Analytics, Werbebanner, Nutzerkommentare, Payment, Fonts und so weiter stützen sich auf Fremddienste, die, oft clientseitig, in den Hauptdienst integriert werden. Hilfsdienste haben meist ihren eigenen Betreiber und sie werden in viele verschiedene SaaS-Dienste eingebunden.
Weniger Aufmerksamkeit erhält beim Blick auf die Cloud die irdische Hälfte des Systems, die Client-Seite. Cloud-Dienste besitzen praktisch immer ein Webinterface, mindestens fürs Management, oft auch – und bei SaaS sowieso – für den eigentlichen Dienst. Der Nutzer bekommt damit eine universelle Client-Umgebung, bestehend aus einem Browser mit generischen Plugins (Flash, Java, Silverlight) und Unterstützungsanwendungen (PDF-Viewer, Office, iTunes) auf dem klassischen PC oder aus einem Browser und anwendungsspezifischen Apps auf mobilen Gadgets wie Smartphones oder Tablets.
Nach dieser langen Vorrede nun zurück zu den Cookies. Das Konzept des Cookies wird demnächst volljährig, es handelt sich ursprünglich um kleine Datenhäppchen, die eine Website einer Browserinstanz zur Speicherung übermittelt. Der Browser merkt sich diese Daten und schickt sie für einen festgelegten Zeitraum bei jeder weiteren Interaktion mit der Website dorthin zurück. Heute gibt es darüber hinausgehende Persistenzmechanismen auch für größere Datenmengen im Browser selbst sowie in verbreiteten Plugins, zum Beispiel im Flash Player.
Jeder Dienst in einer SaaS-Aggregation kann Cookies setzen und mit Hilfe dieser Cookies Daten über das Nutzerverhalten über alle Dienstnutzungen hinweg erfassen und sammeln. Die aggregierten Hilfsdienste erhalten dabei Daten aus verschiedenen SaaS-Anwendungskontexten verschiedener Anbieter und sind gleichzeitig für den Nutzer schwer zu identifizieren. Datenschützer stellen zu Recht die Frage, wie die Dienstnutzer unter diesen Bedingungen wirksam von ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung Gebrauch machen können. Sie geben darauf aber die falschen Antworten.
De jure und traditionell wäre das Problem durch Kommunikation und Vereinbarungen des Nutzers mit jedem einzelnen involvierten Dienstanbieter zu lösen. Aggregierte Hilfsdienste als Auftragsdatenverarbeitung unter einer Vereinbarung zwischen dem Nutzer und dem Anbieter des Hauptdienstes zu subsumieren, wie es etwa für Analytics-Dienste diskutiert wurde, vereinfacht die Sache wegen der Mehrfacheinbettung der Hilfsdienste in verschiedenste SaaS-Anwendungen nur scheinbar. Außerdem ändert sich permanent irgendwo irgendwas, so dass wir als Nutzer am Ende nur noch mit Zustimmen beschäftigt wären, wenn uns keine Generalvollmacht diese Mühe abnimmt. Erforderlich sind Lösungen, die die Architektur von SaaS-Mashups und der Client-Plattform als gegeben hinnehmen und darauf effektive Mechanismen für den technischen Datenschutz bereitstellen.
Cookies sind dabei nur ein wenig kritisches Randphänomen. Da sie clientseitig gespeichert werden, lässt sich ihre Speicherung und Übermittlung auch clientseitig effektiv steuern. Verbesserungsbedarf gibt es dabei vor allem in der Usability. Wünschenswert wäre zum Beispiel ein einheitliches User Interface für Einstellungen über alle Teilsysteme (Browser, Plugins, Apps, etc.) des Clientsystems hinweg anstelle getrennter, inkonsistenter Management-Schnittstellen für Cookies, Persistent DOM Storage und Flash-Cookies. Sinnvoll fände ich auch eine Möglichkeit, meine Datenschutzeinstellungen zwischen meinen fünf regelmäßig genutzten Clientsystemen zu synchronisieren statt fünfmal dasselbe konfigurieren zu müssen. Aber Clientsysteme und ihre Eigenschaften kommen in der Diskussion oft gar nicht vor. Soll ich ernsthaft mit dreiundzwanzig Diensten Vereinbarungen treffen, statt mir einmal eine Policy zusammenzuklicken, die meine eigene Technik für mich durchsetzt? P3P hatte zwar Schwächen und hat sich nicht durchgesetzt, aber damals hat man doch immerhin noch das Gesamtsystem angeschaut und eine Komponente an die richtige Stelle gesetzt, nämlich in den Client.
Mit formalisierten Rechtsritualen aus der Frühzeit der Alltags-IT ist das Problem nicht in den Griff zu bekommen. Gesucht sind effektive und benutzbare Mechanismen. Das ist die technische Sicht, die politische Dimension hat Benjamin Siggel vor einiger Zeit im Spackeria-Blog betrachtet.