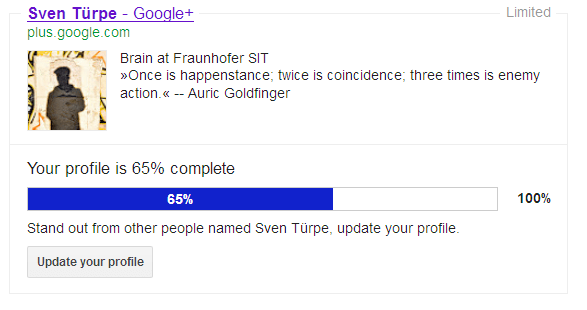[Inhalt – Teil 1 – Teil 2 – Teil 3 – Teil 4 – Teil 5 – Teil 6 (+Nachtrag) – Teil 7]
In der dritten Folge der Artikelserie haben wir betrachtet, dass Google aus Crowdsourcing und Statistik nützliche Funktionen und Dienste baut und dabei aus dem Netz und von seinen Nutzern lernt. Wie funktioniert dieses Lernen?
Eine globale Tankstelle
Stell Dir vor, wir wären die Tankstelle der Welt. Wir verkaufen jede Sorte Treibstoff, die jemals irgendwo entwickelt, benannt und angeboten wurde, jeweils an einer eigenen Zapfsäule. Bei uns tanken deutsche Autofahrer Diesel, Super und Super Plus, Spanier 95 sin plomo und gasóleo, Japaner Hai-oku und Keiyu, Ossis in alten Trabis ihr Zweitaktgemisch VK 88 1:33 und afghanische Taliban brennbare Flüssigkeit aus Fässern und Flaschen.
Unsere Tankstelle ist riesig und unübersichtlich. Wie schicken wir jeden Fahrer mit seinem jeweiligen Fahrzeug an die richtige Säule? Wir könnten unsere Kunden nach ihren Wünschen fragen, aber dazu müssten wir all ihre Sprachen sprechen. Manche Kunden wüssten auch gar nicht, was sie tanken wollen, weil sie gerade in einem geliehenen Fahrzeug sitzen oder weil sie vergesslich sind oder weil ihre robuste russische Technik alles schluckt, was flüssig ist und brennt.
Unsere Kunden hätten zudem unterschiedliche Präferenzen, die teils mit ihren Fahrzeugen zusammenhängen, teils aber auch nicht. Während Mutti ihren Kleinwagen immer genau so betanken möchte, wie es ihr der nette Mann in der Werkstatt schon dreimal aus gegebenem Anlass erklärt hat, ist das Verhalten von Top-Verkäufer Johannes E. komplizierter. Gewohnheitsmäßig kippt er Super++ in seinen Audi, geht eh‘ auf Spesenrechnung und man gönnt sich ja sonst nichts. Ist er aber spät dran und ein Kunde wartet, nimmt er die erstbeste freie Säule, an der er sein Auto nicht kaputtmacht. Dann ist 95 sin plomo eine Alternative zur Schlange an der Super++-Säule, das kennt er aus seinem Urlaub auf Mallorca. Wenn Du mit Johannes E. redest, wirst Du davon allerdings nichts erfahren, weil ihm das selbst nicht so bewusst ist. Seine Bedürfnisse zeigen sich erst, wenn Du sein Verhalten beobachtest. Seine Verhaltensmuster können sich übrigens jederzeit ändern, zum Beispiel weil Johannes E. die Firma und damit den Firmenwagen gewechselt hat. Plötzlich sitzt Johannes E. in einem Mercedes und ein anderer in seinem Audi.
Eine Datenbank hilft uns nicht
Eine klassische Datenbank hilft uns in dieser Situation wenig. Führen wir sie über Fahrzeuge oder Fahrezugtypen, verlieren wir die Fahrerpräferenzen; führen wir sie über Fahrer, bekommen wir deren Wechsel vom Diesel zum Erdgas nicht mit. Bilden wir Paare von Auto und Fahrer, haben wir lauter Spezialfälle in der Datenbank und scheitern jedesmal, wenn eine unbekannte Paarung vorfährt, etwa weil Johannes E. eine Panne hatte und heute einen Mietwagen betankt. Was wir stattdessen haben wollen, ist ein Klassifikator, der fast immer die richtige Entscheidung trifft und dabei vorhandene Informationen generalisiert. Außerdem möchten wir, dass sich unser Klassifikator anpasst, wenn sich die Welt verändert. Wir möchten ihm nicht jede Woche die neuesten Gerüchte aus der Auto BILD und deren Auswirkungen auf seine Tätigkeit einprogrammieren, das soll er schön selbst lernen.
Merkmalsextraktion
Solch einen Klassifikator können wir bauen, und wir können ihn lernfähig machen. Dazu überlegen wir uns zunächst, welche beobachtbaren Merkmale ein Auto nebst Fahrer hat: Farbe, Kennzeichen, Abmessungen, Motor- und Fahrgeräusche, Felgen- und Reifentyp, Anhängerkupplung, Dachgepäckträger, Sauberkeit, Anzahl der Türen, Spoiler, Spracheinstellung des Navigationssystems, eingestellter Radiosender; beim Fahrer Hautfarbe, Körpergröße, Haarschnitt, Gesichtsbehaarung, Kleidung, Gesichtsausdruck und so weiter. Wir sammeln also erst mal alle Merkmale ein, die wir messen können. Welche dieser Daten wir am Ende wirklich brauchen, wissen wir noch nicht genau, voraussichtlich von allen ein bisschen.
Jedes messbare Merkmal liefert uns eine Dimension in einem vieldimensionalen Raum. Fährt ein Auto an unserer Tankstelle vor, können wir es in allen Dimensionen messen und danach als Punkt in diesem Raum darstellen. Kleine Abweichungen, zum Beispiel durch den Wechsel von Winter- zu Sommereifen, führen zu kleinen Verschiebungen im Raum. Große Unterschiede, etwa zwischen Muttis Kleinwagen und Bennos Umzugslaster mit ihren jeweiligen Fahrern, führen zu großen Abständen.

Unser Klassifikator soll uns zu jeder Eingabe – einem Punkt im Raum, der unsere Messwerte zu einem Fahrzeug repräsentiert – eine oder mehrere wahrscheinlich passende Zapfsäulen ausgeben.
Feedback
Wenn unsere Kunden mitdenken und ohne Einweisung oder nach einer falschen Empfehlung selbständig eine für sie richtige Zapfsäule aufsuchen, können wir ihr Verhalten beobachten und daraus lernen. Jedesmal wenn jemand bei uns tankt, bekommen wir ein Datensample, einen Punkt im Raum und die für diesen Punkt richtige Entscheidung. Diese Samples sammeln wir sortiert nach richtigen Entscheidungen. Diese Sammlung könnten wir uns noch als Datenbank vorstellen, in der für jede Zapfsäule sämtliche Merkmale der dort beim Tanken gesehenen Auto-Fahrer-Paare hinterlegt sind. Das sind aber nur Rohdaten und wir werden gleich sehen, dass wir sie gar nicht auf Vorrat in einer Datenbank speichern müssen.
Automatische Verallgemeinerung
Unser Klassifikator soll diese Rohdaten generalisieren können, das heißt auch für solche Datenpunkte gute Entscheidungen treffen, für die bisher keine Beobachtungen vorliegen. Repräsentiert unser Datenraum alle oder die meisten für die Klassifikation relevanten Merkmale, so bilden die Rohdaten zu jeder möglichen Entscheidung einen Cluster: sie liegen näher beieinander als sie zu den Datenpunkten anderer Cluster liegen. In den Randbereichen kann es zu Überschneidungen kommen. Das liegt entweder an verrauschten Daten aufgrund von Messfehlern, oder an fehlenden Merkmalen. Beispielsweise könnten uns einige Parameter fehlen, die das Verhalten unseres Tankchaoten Johannes E. erklären würden, weil wir seinen Terminkalender nicht kennen.
Die maßgebliche Nachbarschaft zwichen den Datenpunkten eines Clusters besteht dabei oft nur in ausgewählten Merkmalsdimensionen, da nicht alle Merkmale gleichermaßen relevant sind. Welche Dimensionen das sind, kann sich von Cluster zu Cluster unterscheiden. Wir könnten an unserer Tankstelle zum Beispiel beobachten, dass rote deutsche Sportwagen fast immer Super tanken, während Lkw sowie silbergraue und schwarze Mittelklassewagen Diesel bevorzugen. Dieser Cluster ließe sich mit den Merkmalen Farbe und Größe recht genau beschreiben. Gleichzeitig könnten wir beobachten, dass Japaner unabhängig von Autotyp und Farbe stets die Säule Hai-oku bevorzugen, weil es ihnen als unhöflich gilt, öffentlich billigen Diesel zu tanken. Daraus ergibt sich wiederum für die anderen Cluster, dass dort das Merkmal Nationalität eine Rolle spielt, und sei es nur die, Japaner aus dem Cluster auszuschließen.
Repräsentanten für Cluster
Damit unser Klassifikator gut funktioniert, benötigt er Beschreibungen der einzelnen Cluster, ihrer Clustergrenzen und ggf. der Überschneidungen mehrerer Cluster. Um einen Datenpunkt zu klassifizieren, also eine Entscheidung zu treffen, müssen wir ihn dem passendsten Cluster zuordnen. Erweist sich eine Klassifikation als falsch, so wollen wir außerdem die betroffenen Clusterbeschreibungen anpassen, ohne uns jedoch von einzelnen Ausreißern unsere Statistik kaputtmachen zu lassen. Anstelle der Rohdaten im Datenbankformat verwendet man dafür Repräsentanten: für jeden Cluster bestimmt man einen Satz von Punkten, der diesen Cluster gut repräsentiert. Diese Repräsentanten liegen irgendwo zwischen den Rohdatenpunkten; ihre Anzahl ist in der Regel geringer.
Für das Beispiel von eben bekämen wir als Repräsentanten des Clusters zur Zapfsäule Hai-Oku gemittelte Erkennungsmerkmale japanischer Fahrer, für Super die gemittelten Merkmale von Sportwagen mit Fahrern, in deren Land Sportwagen Super tanken, und für Diesel gemittelte Merkmale von Lastern sowie von langweilig kolorierten Mittelklassewagen. Die Cluster können komplizierte Formen haben und müssen nicht zusammenhängen, deswegen mehrere Repräsentanten.

Um einen neuen Datenpunkt zu klassifizieren, suchen wir uns den oder die n nächstgelegenen Repräsentanten zu diesem Punkt und bestimmt daraus die Wahrscheinlichkeit der Clusterzugehörigkeit. Wir schicken das Fahrzeug an die Zapfsäule, deren Cluster die höchste Wahrscheinlichkeit hat. Klasse (d.h. Zapfsäule) und Wahrscheinlichkeit die Ausgaben des Klassifikators. Erweist sich die Entscheidung als falsch, analyisieren wir den Fehler und berechnen Korrekturen für die betroffenen Repräsentanten. Diese Korrekturen halten wir klein, Repräsentanten werden nur ein Stückchen in die richtige Richtung verschoben. Das macht unseren Klassifikator robust gegen einzelne statistische Ausreißer. Erst wenn systematische Fehler auftreten, akkumulieren sich viele gleichartige Korrekturen zu einer nennenswerten Verschiebung der Repräsentanten und Clustergrenzen. Beginnen können wir mit zufällig verteilten Repräsentanten; unser Klassifikator wird dann anfangs viele Fehler machen und schnell lernen.
Die Nutzerdaten werfen wir weg
Die ursprünglich erfassten Rohdaten, die gemessenen Merkmalswerte, können wir nach Verwendung wegwerfen. Dass Mutti beim Betanken ihres Kleinwagens immer eine Alditüte mit Einkäufen auf dem Beifahrersitz liegen hat, geht vielleicht als Merkmal in die Klassifikation ein – steht am Ende aber in keiner Datenbank. Wir brauchen diese Information nicht, unseren Klassifikator interessiert nur, ob der das Merkmal Alditüte berücksichten muss und falls ja, was es über die Clusterzugehörigkeit aussagt.
Wer genauer wissen möchte, wie statistische Inferenz und maschinelles Lernen funktioniert, und sich von Formeln nicht abschrecken lässt, findet im Buch Information Theory, Inference, and Learning Algorithms von David MacKay eine hervorragende und umfangreiche Einführung; das komplette Buch mit seinen 600 Seiten gibt es online als PDF-Datei. [Bevor Ihr jetzt anfangt zu drucken: die Amazon-Lieferung dauert auch nicht viel länger.]
In der nächsten Folge schauen wir uns die Leistungsfähigkeit und einige Implikationen dieses Ansatzes an.