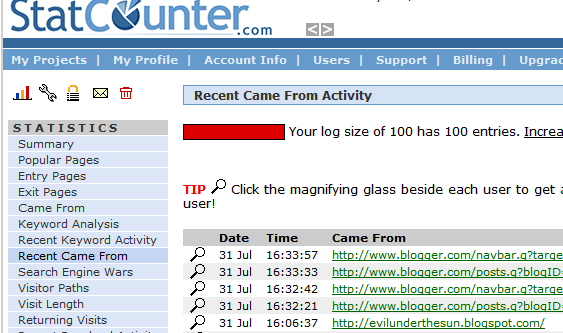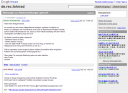Wie oft lasen oder hörten wir diesen Satz: »Datenschutz darf kein Täterschutz sein.« Dann protestierten wir jeweils, wenigstens kurz und in Gedanken, und fühlten uns uns gut, weil wir es ja besser wussten. Datenschutz sei Ausdruck unseres Persönlichkeitsrechts, stehe jedem zu und setze dem Staat Schanken, die wir nicht angetastet sehen wollten. Nie und nimmer, unter gar keinen Umständen, nicht mal gegen Kinderpornonaziterroristenverbrecher. Schäuble war böse, denn er wollte uns übrwachen, und wir waren gut, denn wir waren dagegen. Bis uns jemand einen Fall auf den Leib schneiderte:
»In Deutschland wird die Geheimniskrämerei als Persönlichkeitsrecht missverstanden.«
Das schreibt Ulrike Herrmann in der taz, die wir doch eben noch auf unserer Seite wähnten. Und ein Stück die Zeitung runter legt Sven Giegold nach:
»Zudem muss das steuerliche Bankgeheimnis gelockert werden, so dass Kapitaltransfers ins Ausland systematisch überprüft werden können, ohne dass erst ein Anfangsverdacht vorliegen muss.
(…)
Schließlich könnten wir von Australien lernen: Dort werden die Daten von Kreditkarten aus Steueroasen genutzt, um Steuerflüchtlingen auf die Schliche zu kommen.«
So schlecht ist Überwachung wohl doch nicht, aber selbstverständlich nur gegen die richtigen Verbrecher. Was uns das lehrt: Grundrechte gelten universell, bis wir uns auf einen Gegner geeinigt haben, den wir jetzt aber wirklich echt böse finden. Für den gelten sie nicht mehr, denn jetzt haben wir einen höheren Zweck. Das Entwurfsmuster funktioniert bei jedem, nur den Anlass muss man anpassen.
PS: Und wärend ich das schreibe, schnappen sie einen Datenschützer, der mit einer BND-Agentin verheiratet sein und Steuern hinterzogen haben soll. Das ist so bizarr, das kann man sich gar nicht ausdenken.